
E-Rechnung Landwirtschaft: Das gilt es zu beachten
Mit der zunehmenden Digitalisierung gewinnt die E-Rechnung an Bedeutung. Gesetzliche Vorgaben wie die EU-Richtlinie 2014/55/EU zielen darauf ab, den Einsatz zu fördern und Prozesse effizienter zu gestalten. Wir haben das Wichtigste zusammengefasst.
Die E-Rechnung, oder elektronische Rechnung, ist eine digitale Form der klassischen Papierrechnung, die strukturiert und maschinenlesbar ist. Im Gegensatz zu gescannten Belegen oder PDF-Rechnungen folgt die E-Rechnung spezifischen Standards, wie z. B. XRechnung oder ZUGFeRD, um einen automatisierten Datenaustausch zu ermöglichen.
Ist die E-Rechnung in der Landwirtschaft verpflichtend?

Die EU-Richtlinie 2014/55/EU verpflichtet alle öffentlichen Auftraggeber in den Mitgliedsstaaten, elektronische Rechnungen anzunehmen. In Deutschland sind seit 2020 alle Lieferanten der öffentlichen Hand verpflichtet, E-Rechnungen einzureichen. Für landwirtschaftliche Betriebe gilt dies insbesondere bei Geschäften mit öffentlichen Einrichtungen.
Für im Inland steuerbare Umsätze ist der Empfang und die Verarbeitung einer E-Rechnung im B2B-Geschäftsverkehr ab 1. Januar 2025 im Unternehmen zu ermöglichen – ohne vorherige Zustimmung des Empfängers.
Die grundsätzliche Verpflichtung zur Ausstellung einer elektronischen Rechnung gilt ebenfalls ab 1. Januar 2025. Angesichts des zu erwartenden hohen Umsetzungsaufwandes für die Unternehmen hat der Gesetzgeber jedoch Übergangsregelungen für die Jahre 2025 bis 2027 für Rechnungsaussteller vorgesehen.
Während die gesetzliche Nutzung klar definierten Standards folgt, können freiwillige Anwender zwischen verschiedenen Formaten wählen, je nach Bedarf und technischer Ausstattung.
E-Rechnung in der Praxis
Eine E-Rechnung folgt bestimmten Formaten wie XRechnung oder ZUGFeRD, die strukturierte Daten enthalten. Dies ermöglicht eine automatisierte Verarbeitung durch Buchhaltungs- und Warenwirtschaftssysteme. Die Übermittlung erfolgt per E-Mail (mit standardisiertem XML-Anhang) oder über EDI-Systeme (Electronic Data Interchange).
Eine digitalisierte Rechnung ist im Vergleich dazu ein gescannter Beleg oder ein einfaches PDF, das nicht maschinenlesbar ist und manuell verarbeitet werden muss.
Format und Aufbau einer E-Rechnung
Deutschland hat zwei Formate für elektronische Rechnungen eingeführt:
- XRechnung: Standard für den Datenaustausch im öffentlichen Sektor in Deutschland.
- ZUGFeRD: Kombiniert strukturierte Daten mit einer visuellen Darstellung in PDF-Form.
Beide Formate erfüllen die Anforderungen der EN 16931.
Vorteile und Herausforderungen der E-Rechnung
Die E-Rechnung bietet zahlreiche Vorteile, bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich, die es zu bewältigen gilt. Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte detailliert beleuchtet:
Vorteile der E-Rechnung:
- Zeitersparnis: Durch die automatisierte Verarbeitung von E-Rechnungen entfällt die manuelle Eingabe von Daten. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch die Fehlerquote erheblich. Prozesse wie die Rechnungsprüfung und Freigabe werden beschleunigt, was insbesondere in der landwirtschaftlichen Buchhaltung mit vielen wiederkehrenden Vorgängen von Vorteil ist.
- Papierreduktion: Der Umstieg auf elektronische Rechnungen ermöglicht einen nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen. Durch den Verzicht auf Papierrechnungen werden Druck-, Lager- und Versandkosten eingespart, während gleichzeitig der ökologische Fußabdruck des Unternehmens reduziert wird.
- Schnellere Zahlungseingänge: Die strukturierte und standardisierte Übermittlung von Rechnungsdaten sorgt für eine schnellere Verarbeitung auf Seiten der Kunden und Lieferanten. Dies führt in vielen Fällen zu einem beschleunigten Zahlungseingang, was die Liquidität des Betriebs verbessert.
Herausforderungen der E-Rechnung:
- Datenschutz: Die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist ein wesentlicher Aspekt bei der Nutzung von E-Rechnungen. Sensible Daten müssen vor unbefugtem Zugriff geschützt werden, und es ist sicherzustellen, dass alle Beteiligten datenschutzkonform arbeiten.
- IT-Sicherheit: Die Umstellung auf elektronische Rechnungen erfordert eine robuste IT-Infrastruktur. Cyberangriffe oder technische Ausfälle könnten sensible Daten gefährden. Daher ist es notwendig, in geeignete Sicherheitsmaßnahmen wie Firewalls, Verschlüsselungstechnologien und regelmäßige Updates zu investieren.
- Akzeptanz: Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Bereitschaft, auf E-Rechnungen umzusteigen. Nicht alle Unternehmen verfügen über die notwendigen technischen Voraussetzungen oder sehen den Nutzen auf den ersten Blick, was die Einführung erschweren kann.
Lösungsansätze zur Bewältigung der Herausforderungen:
- Klare Kommunikation der Vorteile: Die Vorteile der E-Rechnung sollten klar und verständlich kommuniziert werden, um Partner und Lieferanten zu motivieren. Hierbei können Beispiele und Erfolgsgeschichten aus der Praxis helfen, Vorbehalte abzubauen.
- Investition in sichere IT-Infrastrukturen: Der Schutz sensibler Daten muss höchste Priorität haben. Investitionen in moderne IT-Lösungen und Sicherheitsstandards schaffen Vertrauen und reduzieren das Risiko von Datenverlust oder Missbrauch.
- Schulungen und Webinare: Die Schulung von Mitarbeitern kann helfen, die Akzeptanz zu steigern und den Umgang mit der neuen Technologie zu erleichtern. So wird sichergestellt, dass alle Beteiligten von der Umstellung profitieren.
E-Rechnung in der landwirtschaftlichen Buchhaltung
Die technischen Voraussetzungen beinhalten eine aktuelle Buchhaltungssoftware mit E-Rechnungsfunktionalität (z.B. AGRARMONITOR) sowie einen Internetzugang und gegebenenfalls spezielle Hardware wie Computer oder Tablets.
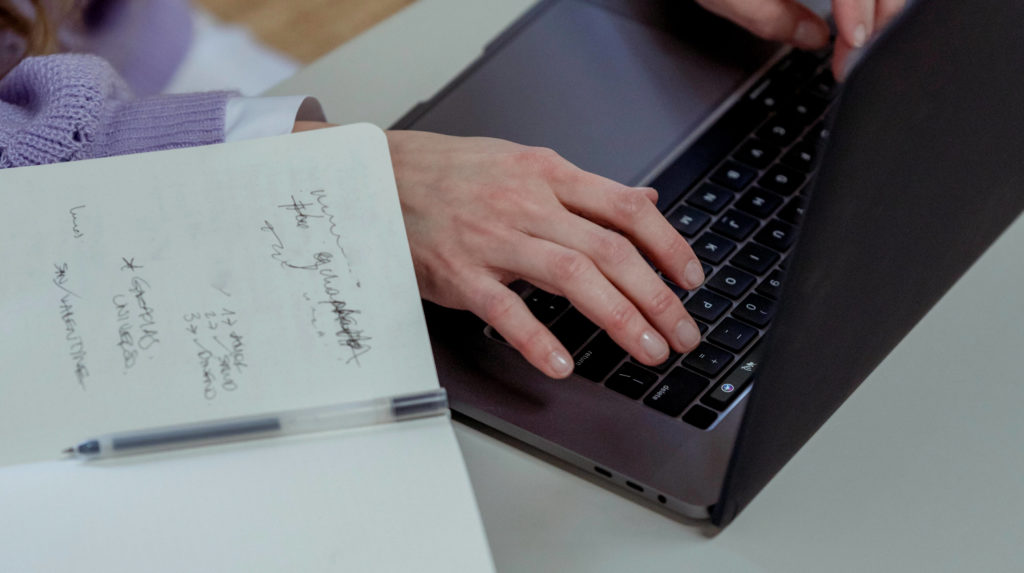
Bestenfalls verknüpfen Sie die E-Rechnung mit Ihrem Warenwirtschafts- und Buchhaltungssystem. Es ist empfehlenswert mit einer Pilotphase mit ausgewählten Partnern zu starten und das Altsystem schrittweise abzulösen. Externe Berater können Sie dabei unterstützen.
Softwarelösungen für E-Rechnungen in der Landwirtschaft
Angepasst auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von landwirtschaftlichen Betrieben und Lohnunternehmen bietet der Markt inzwischen eine breite Palette an Programmen, die sich mit dem Thema Rechnungserstellung beschäftigen und seit neuestem auch mit E-Rechnungen. Am bekanntesten ist wahrscheinlich DATEV, da viele Steuerberater darauf zurückgreifen. Hierüber sind z.B. Finanzbuchführung und Gehaltsabrechnungen möglich.
Suchen Sie allerdings nach einer Komplettlösung inkl. Auftragserfassung, Ackerschlagverwaltung, Disposition, digitalem Belegmanagement, Rechnungserstellung (inkl. E-Rechnung) u.v.m., dann ist AGRARMONITOR die Lösung für Sie. Speziell auf landwirtschaftliche Betriebe zugeschnitten beinhaltet die Software alles, was Sie benötigen. Dank diverserer individuell einstellbarer Schnittstellen (z.B. zu DATEV) ist die Software auch direkt mit dem Steuerbüro oder zu anderen Programmen und Herstellern verbunden.
Fazit: Warum E-Rechnungen die Zukunft sind
Die E-Rechnung bietet (landwirtschaftlichen) Betrieben erhebliche Vorteile, von der Zeit- und Kostenersparnis bis hin zur Umweltfreundlichkeit. Trotz Herausforderungen wie Datenschutz und IT-Sicherheit sind die langfristigen Vorteile überzeugend. Eine schrittweise Einführung und die Nutzung bewährter Softwarelösungen erleichtern den Umstieg.
Landwirtschaftliche Betriebe sollten frühzeitig mit der Umstellung beginnen, um von den Vorteilen zu profitieren und den Anschluss an die Digitalisierung nicht zu verpassen. Weitere Unterstützung bieten beispielsweise die Kundenbetreuer von AGRARMONITOR, diverse Webinare und Schulungen.
